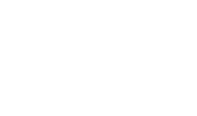Stolpersteine für Georg und Pia von Hevesy
Mit je einem Stolperstein für Prof. Dr. Georg von Hevesy und seiner Ehefrau Pia von Hevesy an ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Rosastraße 21 und einem weiteren für den Nobelpreisträger am Zugang zu seiner ehemaligen Wirkungsstätte dem Institut für Physikalische Chemie der Universität Freiburg, gedenkt die Initiative "Stolpersteine in Freiburg" dem Ehepaar Hevesy. Die Steine sind am 15. Juli 2014 verlegt worden.
Georg von Hevesy, geboren 1885 in Budapest/Ungarn, gilt als der "Vater der Nuklearmedizin" und erhielt für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen 1943 den Nobelpreis für Chemie.
In Freiburg verbrachte er Teile seines Studiums, wurde 1908 bei Georg Meyer promoviert und schließlich 1926 zum Professor für Physikalische Chemie an der Universität Freiburg ernannt. Von 1931 bis 1933 war er Dekan der Mathematisch Naturwissenschaftlichen Fakultät. Während seiner Freiburger Zeit war er sehr engagiert, seine Studenten optimal auszubilden und das Institut zu modernisieren. So warb er u.a. umfangreiche Mittel aus der Rockefeller Stiftung für den Ausbau des Institutsgebäudes (Albertstraße 23 a) ein. Wissenschaftlich erfand er in dieser Zeit u.a. die Röntgenfluoreszenzanalyse und die Isotopenverdünnungsmethode, wandte erstmals natürliche Radioisotope in der Tierphysiologie an, sowie ein stabiles Isotop zur Untersuchung des Stoffwechsels (im Tier- und Eigenversuch) und entdeckte die Radioaktivität des Samariums.
Foto: Georg von Hevesy (7. von links) und Georg Meyer (5. von links) mit Arbeitsgruppe um 1930
Quelle: Institut für Physikalische Chemie der Universität Freiburg
Von Hevesy zog mit seiner Frau Pia in die Rosastraße. Drei der vier Kinder kamen in Freiburg zur Welt. Nach langen Wanderjahren mit Stationen in Budapest, Zürich, Karlsruhe, Manchester (wo er mit Hilfe der Röntgenfluoreszenz das Element Hafnium entdeckte) und Wien, war er überzeugt endlich seine endültige Position gefunden zu haben - doch es sollte anders kommen. "Es ist interessanterweise das einzige Mal, dass Georg von Hevesy eine planmäßige Professur inne hatte und nicht ausschließlich als Gastwissenschaftler über Projektmittel beschäftigt war.", so Prof. Dr. Peter Gräber. Gemeinsam mit Prof. Dr. Gerd Kothe hatten beide bei einer Begehung der Stolpersteine mit Marlis Meckel, der Initiatorin von "Stolpersteine in Freiburg", den Gedanken, von Hevesy auch im öffentlichen Raum ein Zeichen zum Gedenken an das dunkle Kapitel der Nazizeit zu setzen.
Mit der Machtergreifung der Nazionalsozialisten kam es zu einer zunehmenden politischen Vergiftung des universitären Umfelds und diversen "Säuberungen". So musste von Hevesy bereits im Juli 1933 zu seiner Situation als "Jude und Beamter" Stellung beziehen. Doch von Hevesy hielt noch ein Jahr durch bis er schließlich im Herbst 1934 mit seiner Familie nach Dänemark emigrierte. "Es ist beeindruckend, dass von Hevesy in diesem hasserfüllten Umfeld seine Lehre bis zum Ende des Semesters durchgezogen hat", sagt Marlis Meckel. Der Nazi-Terror sollte ihn und seine Familie jedoch auch in Dänemark erreichen, wo sie 1943 - mit tausenden anderen Juden - von Dänen über den Sund nach Stockholm/Schweden gerettet werden konnten. In Stockholm setzte er seine wissenschaftliche Karriere fort und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.
Kurz vor seinem 80. Geburtstag kehrte das Ehepaar von Hevesy nach Freiburg zurück. Hevesy wollte in Freiburg begraben werden und erklärte den Ort damit zu seiner Heimatstadt. "Es hat mich tief berührt, dass von Hevesy hier keineswegs den Groll im Herzen hatte, als Jude und Ausländer diskriminiert und aus der Stadt vertrieben worden zu sein", so Marlis Meckel. Georg von Hevesy verstirbt 1966 in Freiburg und wird wie Pia von Hevesy nach ihrem Tod 1979 in Freiburg-Littenweiler beerdigt. 2001 werden die sterblichen Überreste des Ehepaars von Hevesy nach Budapest überführt und dort beigesetzt.
Ab Juli wird nun also auch ein Stolperstein beim Eingang des Institutsviertels an Georg von Hevesy und seinen damals täglichen Gang zu seiner Wirkungsstätte erinnern. Das Institut für Physikalische Chemie begrüßt und unterstützt dies ausdrücklich und bedankt sich herzlich bei der Initiatorin Marlis Meckel sowie Prof. Dr. Peter Gräber und Prof. Dr. Gerd Kothe für deren Engagement.